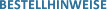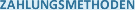Fotorecht

Fotorecht
389 Seiten.
Nr. 07601
Eine einzige Fotografie stellt bereits eine rechtliche Gemengelage dar: Welche Rechte erhält der Fotograf? Wer oder was darf ohne Einwilligung abgebildet werden? Darf die Fotografie veröffentlicht und verwertet werden?
Welche Besonderheiten gilt es im Internet zu beachten? Diese Fragen stellen Fotografen und Fotonutzer in rechtlicher und auch praktischer Hinsicht in der Regel vor große Herausforderungen. .Fotorecht" versucht, in anschaulicher Weise Lösungen auf diese Fragen anzubieten. Das Werk enthält neben einer ausführlichen Darstellung der wirtschaftlichen Aspekte des Fotomarktes und des berufstätigen Fotografen einen umfassenden Überblick über das Urheberrecht im Zusammenhang mit Fotografien. Dazu gehören die Entstehung des Urheberschutzes samt der jeweiligen Rechte, Fragen der Lizenzierung und der Verfolgung von Rechtsverletzungen.
Gleichermaßen informativ wird außerdem auf allgemeine vertragsrechtliche Fragen eingegangen, wie den - Besonderheiten der Allgemeinen Geschäftsbedingungen, sowie auf Grundlagen des Persönlichkeitsschutzes.Vorwort
Bearbeiterverzeichnis
Inhaltsverzeichnis
Abkürzungsverzeichnis
Teil 1: Technische und wirtschaftliche Grundlagen
A. Technische Grundlagen der Fotografie
I. Die Geschichte der Fotografie
1. Physikalische Entdeckungen
2. Chemische Entdeckungen
3. Die ersten Fotografien
4. Der erste Rollfilm
5. Die weitere Entwicklung bis heute
II. Der aktuelle Stand der Fototechnik
1. Wie entsteht ein analoges Bild?
a) Der Verschlussvorhang
b) Die Blende
c) Die Blendenöffnung
d) Der Belichtungsmesser
e) Der gestalterische Umgang mit Blende und Verschlusszeit
f) Selektive Schärfentiefe
2. Kameratypen
a) Großformatkameras
b) Das Kleinformat
c) Das Mittelformatsystem
3. Die Objektivpalette
a) Die Brennweite
b) Die Lichtstärke
4. Das Filmmaterial
a) Filmempfindlichkeit
b) Negativ- und Positivfilm
c) Spezialfilme
5. Die Filter
6. Die Digitaltechnik
a) CCD-Sensor
b) CMOS-Sensor
c) Vor- und Nachteile der beiden Sensor-Systeme
d) Digitale Kameramodelle
e) Analog – contra Digitaltechnik
III. Fotografisches Sehen
B. Wirtschaftliche Grundlagen und Organisation des Fotomarktes
I. Ursprünge
II. Der Fotograf
1. Der Amateurfotograf
2. Der professionelle Fotograf
a) Ausbildungsmöglichkeiten zum Fotografen
b) Fotojournalisten
c) Studiofotografen
d) Der Bildende Künstler (Kunstfotograf)
III. Die Fotoindustrie
IV. Vermarktung und Lizenzierung
1. Bildagenturen
a) Universalagenturen
b) Fachagenturen
aa) Pressebildagenturen
bb) Spezialbildagenturen
cc) Microstockagenturen
2. „Verwertungsgesellschaft Bild-Kunst“
3. Galerien
a) „Lumas“
b) Online-Bildergalerien
4. Auktionshäuser
V. Die Verwender
1. Zeitungen und Zeitschriften
2. Kunstbuchverlage
3. Das Foto im Internet
Teil 2: Die Fotografen und ihre Rechte
A. Fotografie und Urheberrecht
I. Urheberrecht der Fotografen
1. Urheberrechtlicher Schutz von Fotos
a) Lichtbildwerk
aa) Persönliche Schöpfung
bb) Geistiger Gehalt
cc) Konkretisierung in sinnlich wahrnehmbarer Form
dd) Gestaltungshöhe
ee) Beispiele
b) Lichtbild
2. Urheberrechtlicher Schutz von Filmausschnitten
a) Screenshots
b) Film-Stills
3. Schutzdauer
4. Urheberpersönlichkeitsrechte und Verwertungsrechte
a) Allgemein
b) Urheberpersönlichkeitsrechte
aa) Veröffentlichungsrecht, § 12 UrhG
bb) Anerkennung der Urheberschaft, § 13 UrhG
cc) Entstellung des Werkes, § 14 UrhG
dd) Beispiele
c) Verwertungsrechte des Urhebers
aa) Vervielfältigungsrecht, § 16 UrhG
bb) Verbreitungsrecht, § 17 UrhG
cc) Ausstellungsrecht, § 18 UrhG
dd) Vortrags-, Aufführungs- und Vorführungsrecht, § 19 UrhG
ee) Recht der öffentlichen Zugänglichmachung, § 19a UrhG
ff) Senderechte, §§ 20 ff. UrhG
gg) Bearbeitungsrecht, § 23 UrhG
5. Gesetzliche Einschränkungen
a) Unentgeltliche Einschränkungen
aa) Vorübergehende Vervielfältigung, § 44a UrhG
bb) Rechtspflege und öffentliche Sicherheit, § 45 UrhG
cc) Berichterstattung über Tagesereignisse, § 50 UrhG
dd) Zitatrecht, § 51 UrhG
ee) Bildnisse, § 60 UrhG
b) Entgeltliche Einschränkung
aa) Sammlungen für Kirchen-, Schul- oder Unterrichtsgebrauch, § 46 UrhG
bb) Vervielfältigung, Verbreitung und öffentliche Wiedergabe von Abbildungen, die in Zusammenhang mit Zeitungsartikeln stehen, § 49 UrhG
cc) Öffentliche Zugänglichmachung und Vervielfältigung für Unterricht und Forschung, § 52a UrhG
dd) Wiedergabe an elektronischen Leseplätzen, § 52b UrhG
ee) Privatkopie, §§ 53, 54 UrhG
6. Beteiligung mehrerer (§§ 8, 9 UrhG)
II. Besonderheiten der digitalen Fotografie
1. Nutzungsmöglichkeiten digitaler Fotografien und der elektronischen Bildverarbeitung
2. Rechtlicher Schutz der elektronischen Bildaufzeichnung und -verarbeitung
a) Urheberrechtlicher Schutz elektronischer Bildaufzeichnungen
aa) Einordnung elektronischer Bildaufzeichnungen als Lichtbild(-werk)
bb) Schutzdauer
b) Schutz bei der Digitalisierung bestehender Fotografien
c) Schutz der elektronischen Bildherstellung und -bearbeitung mittels Computer
3. Persönlichkeitsrechtliche Besonderheiten im Rahmen der elektronischen Bildverwertung und -verarbeitung
a) Die Veröffentlichung digitaler Bilder
b) Die Urheberbezeichnung bei digitalen Bildern und Fotomontagen
c) Veränderung der fotografischen Vorlage
d) Beschränkungen der Bildmanipulation durch das Recht am eigenen Bild oder das allgemeine Persönlichkeitsrecht
4. Betroffene Verwertungsrechte im Rahmen der elektronischen Bildverarbeitung
a) Automatische Speichervorgänge im Rahmen der Bildnutzung
b) Öffentliche Zugänglichmachung von Bildern
c) Keine Erschöpfung bei der Online-Übermittlung von Bildern
5. Zulässigkeit und Grenzen der digitalen Bildbearbeitung und -manipulation
a) Die Einordnung einer digitalen Bildbearbeitung in die urheberrechtlichen Tatbestände
b) Die Herstellung einer Bearbeitung ohne Zustimmung des Berechtigten
c) Veröffentlichung oder Verwertung einer elektronisch bearbeiteten Bilddatei
d) Rechte an der digital bearbeiteten bzw. manipulierten Bilddatei
e) Schutz des Betrachters und der abgebildeten Personen
6. Vertragliche Vereinbarungen im Rahmen der digitalen Bildnutzung und -verarbeitung
a) Zur Möglichkeit der Rechtseinräumung für unbekannte Nutzungsarten
b) Die Bedeutung ausdrücklicher Vereinbarungen
III. Urheberrechtliche Ansprüche bei unberechtigter Nutzung
1. Ansprüche aus dem Urheberrecht
a) Schadensersatzansprüche
aa) Verletzung
bb) Widerrechtlichkeit
cc) Verschulden
dd) Kausaler Schaden
ee) Rechtsfolge
(1) Tatsächlicher Schaden
(2) Verletzergewinn
(3) Angemessene Lizenzgebühr
b) Unterlassungsansprüche
aa) Wiederholungsgefahr
bb) Erstbegehungsgefahr
c) Beseitigungsansprüche
d) Vernichtungs-, Rückruf- und Überlassungsansprüche
e) Auskunftsansprüche
2. Ansprüche aus dem allgemeinen Zivilrecht
3. Durchsetzung urheberrechtlicher Ansprüche
a) Außergerichtliche Durchsetzungsmöglichkeiten
b) Gerichtliche Durchsetzungsmöglichkeiten
aa) Zuständigkeit
bb) Prozessführungsbefugnis
cc) Klagegegner
B. Urhebervertragsrecht und allgemeines Vertragsrecht
I. Grundsätze des Urhebervertragsrechts
1. Keine Übertragung des Urheberrechts in toto
2. Einfache und ausschließliche Nutzungsrechte
3. Zweckübertragungsgrundsatz
4. Beschränkung von Nutzungsrechten
a) Räumliche Beschränkung
b) Zeitliche Beschränkung
c) Inhaltliche Beschränkung
5. Die angemessene Vergütung, § 32 UrhG
6. Weitere finanzielle Beteiligung, § 32 a UrhG
7. Bei Vertragsschluss unbekannte Nutzungsarten
8. Einräumung weiterer Nutzungsrechte an Dritte
II. Grundsätze des allgemeinen Vertragsrechts
1. Zustandekommen von Verträgen
a) Angebot und Annahme
b) Stellvertretung
2. Wirksamkeit von Verträgen
a) Anfechtung
b) Sittenwidrigkeit
c) Minderjährige
d) Formvorschriften
3. Allgemeine Geschäftsbedingungen
a) Begriff der AGB
b) Einbeziehung der AGB und Vorrang individueller Abreden
c) Inhaltskontrolle
aa) Generalklausel
bb) Sonderfall des sog. „Buy-Out“ der Rechte
cc) Spezielle Klauselverbote
(1) Klauselverbote ohne Wertungsmöglichkeit, § 309 BGB
(2) Klauselverbote mit Wertungsmöglichkeit, § 308 BGB
dd) Schriftformklauseln
III. Besondere Verträge
1. Verträge über Fotorechte, Fotoproduktionsverträge und Verträge über fotografische Kunstobjekte
a) Lizenzverträge
aa) Verträge mit Bildagenturen
(1) Bildagenturvertrag
(a) Rechtsnatur
(b) Nutzungsrechtsumfang
(c) Vergütung/Erlösverteilung
(d) Haftung
(e) Vertragsbeendigung
(2) Verträge zwischen Agentur und Verwertern
(a) Geschäftspraxis
(b) Rechtsnatur
(c) Nutzungsrechtsumfang
(d) Vergütung
(e) Urhebernennung und Agenturvermerk
(f) Rückgabe des Bildmaterials
(g) Haftung
(h) Vertragsstrafen und Schadenspauschalen
(3) Royalty-Free-Lizenzen und Creative Commons
bb) Verträge mit Verlagen
(1) Verträge zwischen Fotografen und Buchverlagen
(2) Verträge mit Zeitungs- und Zeitschriftenverlagen
b) Fotoproduktionsverträge
aa) Rechtliche Einordnung
bb) Vertragspflichten
(1) Pflichten des Fotografen
(a) Erbringung der Werkleistung
(b) Nutzungsrechtseinräumung
(c) Nebenleistungen
(2) Pflichten des Auftraggebers
(a) Abnahme
(b) Vergütung
cc) Haftung bei Pflichtverletzungen
(1) Sach- und Rechtsmängel
(2) Verletzung von Treuepflichten
dd) Sonstige vertragliche Bestimmungen
ee) Standfotos
ff) Bildnisbestellungen
c) Verträge über fotografische Kunstobjekte
aa) Ausstellungs- und Galerieverträge
bb) Kommissionsverträge
cc) Kaufverträge
2. Honorarverträge für Fotomodelle
a) Das Modell und sein Umfeld
aa) Der Kunde
bb) Das Fotomodell
cc) Die Arbeitsvermittlung
(1) Die Künstlervermittlung
(2) Die Modellagentur
b) Der Vertrag zwischen dem Modell und dem Kunden
aa) Rechtsnatur des Vertrages
bb) Nutzungsrechte
(1) Die Einwilligung
(2) Der Umfang
(a) Verwendungszweck
(b) Nutzungsform
(c) Dauer
(3) Die Beseitigung der Einwilligung
(a) Unwiderruflichkeitsklauseln
(b) Wirkung des Widerrufs
(c) Minderjährige Modelle
(d) Körperteilmodelle
(e) Der Velma
cc) Die Buchungsbedingungen
(1) Buchungsgrundlage
(2) Nutzungsrechte
(3) Honorarvereinbarung, Reisekosten
(4) Erfüllungshindernisse
dd) Problematik der Buchungsbedingungen
IV. Verwertungsgesellschaften
1. Der Zweck von Verwertungsgesellschaften
2. Die für Fotografen zuständige Verwertungsgesellschaft – die VG Bild-Kunst
3. Wahnehmungs- und Gegenseitigkeitsverträge
4. Rechtsverhältnis zu den Nutzern
5. Verteilung der Einnahmen der VG Bild-Kunst
Teil 3: Sonstige rechtliche Rahmenbedingungen
A. Sachfotografie
I. Fotos von urheberrechtlich geschützten Motiven
1. Welche Motive genießen Urheberschutz?
a) persönliche geistige Schöpfung
b) zeitliche Begrenzung des Urheberschutzes
2. Konsequenzen des Urheberschutzes des abgebildeten Motivs
a) Einwilligung des Urhebers des abgebildeten Gegenstandes
b) Urheberpersönlichkeitsrecht, Änderungsverbot und Quellenangabe
3. Ausnahmen vom Einwilligungserfordernis – die Schranken des Urheberrechts
a) Die Privilegierungen der §§ 45 – 47 UrhG
b) Berichterstattung über Tagesereignisse (§ 50 UrhG)
c) Zitatrecht (§ 51 UrhG)
d) Unterrichts- und Forschungszwecke (§ 52 a UrhG)
e) Vervielfältigung zum privaten Gebrauch (§ 53 UrhG)
f) Unwesentliches Beiwerk (§ 57 UrhG)
g) Werke in Ausstellungen, öffentlichem Verkauf und öffentlich zugänglichen Einrichtungen (§ 58 UrhG)
h) Panoramafreiheit (§ 59 UrhG)
aa) an öffentlichen Wegen, Straßen und Plätzen gelegen
bb) bleibend
cc) Perspektive von einem allgemein zugänglichen Standort
II. Eigentum und Hausrecht
1. Eigentum
a) Fotografieren fremder Häuser von allgemein zugänglichem Standort
b) Fotografieren fremder Gegenstände von allgemein zugänglichem Standort
c) Fotografieren von Gebäuden und Gegenständen unter Betreten fremder Grundstücke
2. Hausrecht
a) Umfang des Hausrechts
b) Verwertung von Fotografien, die unter Verletzung des Hausrechts gefertigt wurden
III. Allgemeines Persönlichkeitsrecht
1. Abbildungen der Innen- oder Außenansicht der Wohnung
a) Abbildungen aus dem Inneren der Wohnung
b) Abbildungen der Außenansicht von Wohnhäusern
2. Unternehmenspersönlichkeitsrecht
IV. Gewerbliche Schutzrechte
1. Marken und geschäftliche Bezeichnungen
2. Geschmacksmuster
V. Wettbewerbsrecht
B. Personenfotografie
I. Anfertigen von Personenfotos
II. Verbreiten und Veröffentlichen von Personenfotos
1. Bildnis
a) Personenbildnis
aa) Leichenfotos
bb) Doppelgänger
b) Erkennbarkeit
aa) Erkennbarkeit aufgrund der Abbildung selbst
bb) Erkennbarkeit aufgrund begleitender Umstände
2. Einwilligung
a) ausdrücklich oder stillschweigend erteilte Einwilligung
b) Vermutung der Einwilligung (§ 22 Satz 2 KUG)
c) Stellvertretung
d) Geschäftsfähigkeit
aa) Geschäftsunfähige
bb) Beschränkt Geschäftsfähige
e) Einwilligung nach dem Tod des Abgebildeten
f) Nichtigkeit der Einwilligung
g) Reichweite der Einwilligung
h) Anfechtung und Widerruf der Einwilligung
3. Veröffentlichung ohne Einwilligung – die Ausnahmetatbestände des § 23 Abs. 1 KUG
a) Bildnisse aus dem Bereich der Zeitgeschichte (§ 23 Abs. 1 Nr. 1 KUG)
aa) Die frühere Rechtsprechung – Die Person der Zeitgeschichte
bb) Die neue Rechtsprechung – Das abgestufte Schutzkonzept
cc) Begleitende Wortberichterstattung
dd) Die Intimsphäre des Abgebildeten
(1) Nacktfotos
(2) Leichenfotos
ee) Die Privatsphäre des Abgebildeten
(1) Häuslicher Bereich
(2) Privatsphäre außerhalb des häuslichen Bereichs
(3) Alltagssituationen
(4) Kinder und Eltern-Kind-Beziehungen
(5) Beschränkung des Privatsphärenschutzes durch Vorverhalten
ff) Kommerzielle Nutzung
gg) Beteiligte an Ermittlungsverfahren und Strafprozessen
(1) Täter
(2) Jugendliche Straftäter
(3) Verdächtige
(4) Anspruch auf Resozialisierung
(5) Richter, Staatsanwälte, Rechtsanwälte
(6) Opfer
b) Personen als Beiwerk (§ 23 Abs. 1 Nr. 2 KUG)
c) Bilder von Versammlungen, Aufzügen und ähnlichen Vorgängen (§ 23 Abs. 1 Nr. 3 KUG)
d) Bildnisse im Interesse der Kunst (§ 23 Abs. 1 Nr. 4 KUG)
4. Entgegenstehende berechtigte Interessen des Abgebildeten (§ 23 Abs. 2 KUG)
a) Herabwürdigung, Anprangerung und sonstige Verächtlichmachung
b) Umstände bei der Anfertigung von Fotografien c) Fotomontagen und digitale Veränderungen
5. Rechtslage nach dem Tod des Abgebildeten
a) Postmortaler Bildnisschutz (§ 22 S. 3 KUG)
b) Postmortales Persönlichkeitsrecht
III. Rechtsfolgen der Verletzung des Rechts am eigenen Bild
1. Zivilrechtliche Folgen
a) Unterlassung
aa) Voraussetzungen
bb) Anspruchsverpflichtete
cc) Umfang des Unterlassungsanspruchs
b) Gegendarstellung
c) Widerruf und Richtigstellung
d) Materieller Schadensersatz
e) Immaterieller Schadensersatz/Geldentschädigung
aa) Schwerwiegende Rechtsverletzung
(1) Verletzung der Intimsphäre
(2) Verletzung der Privatsphäre
(3) Kommerzielle Nutzung
(4) Herabwürdigung/ehrenrühriger Kontext
(5) Hartnäckigkeit
bb) Ultima Ratio
f) Ungerechtfertigte Bereicherung
aa) Voraussetzungen
bb) Höhe der fiktiven Lizenzgebühr
g) Verhältnis des Schadensersatz- und Bereicherungsanspruchs zum Anspruch auf Geldentschädigung
h) Hilfsansprüche
aa) Auskunftsanspruch
bb) Vernichtungs- und Herausgabeanspruch
2. Strafrechtliche Folgen
a) § 33 KUG
b) § 201a StGB
C. Gesetzliche Fotografierverbote
I. Gerichtsberichterstattung
1. Aufnahmen während der Gerichtsverhandlung
a) Bewegtbilder
b) Fotografien
c) Verhandlungen vor dem Bundesverfassungsgericht
2. Aufnahmen außerhalb der Gerichtsverhandlung
3. Sitzungspolizeiliche Anordnungen
II. Militärischer Bereich
1. Schutzbereichgesetz
2. Sicherheitsgefährdendes Abbilden militärischer Einrichtungen
3. Aufnahmen aus der Luft
D. Zutrittsrechte
I. Veranstaltungen privater Veranstalter
1. Landespressegesetze
2. Versammlungsrecht
3. Recht auf Kurzberichterstattung
a) Voraussetzungen
b) Einschränkungen
c) Umfang
4. Verbot vorsätzlicher, sittenwidriger Schädigung (§ 826 BGB)
II. Veranstaltungen staatlicher Stellen
1. Landespressegesetze
2. Pressefreiheit und Gleichbehandlungsgrundsatz
3. Zugang zu Gerichtsverhandlungen
4. Zugang zu den Verhandlungen des Bundestages
Teil 4: Der Fotograf im Beruf
A. Abgrenzung von Kunst und Gewerbe
I. Allgemeines
II. Allgemeine Kriterien zur Abgrenzung von Kunst und Gewerbe
1. Der Begriff der Kunst
2. Präzision
a) Früherer Ansatz
b) Entwicklungen in der neueren Rechtsprechung
aa) Personenbezogene Kriterien
(1) Ausbildung
(2) Werdegang
(3) Gewerbe- oder Handelsregistereintragung
(4) Gruppen- oder Verbandszugehörigkeit
(5) Innere Einstellung
bb) Ergebnis- bzw. produktbezogene Merkmale
(1) Eigenschöpferische Leistung
(2) Vertriebsweg
(3) Verwendungszweck
3. Zusammenfassung
III. Folgen der Abgrenzung
1. Gewerbsmäßiges Handeln
a) Handwerksordnung
b) Gewerbeordnung
c) Handelsgesetzbuch
2. Künstlerische Tätigkeit
B. Urheberrechtliche Besonderheiten bei Fotografen in Arbeitnehmerstellung
I. Allgemeines
II. Regelungsgehalt des § 43 UrhG
1. In Erfüllung der arbeitsvertraglichen Verpflichtungen
2. Einschränkung der allgemeinen urheberrechtlichen Regelungen
3. Einräumung von Nutzungsrechten
4. Keine gesonderte Vergütung
5. Einschränkung der Urheberpersönlichkeitsrechte
III. Arbeits- und Tarifverträge
1. Redaktionell angestellte Fotografen in Zeitungsverlagen
2. Redaktionell angestellte Fotografen in Zeitschriftenverlagen
3. Journalistisch tätige Fotografen in arbeitnehmerähnlicher Position
C. Besonderheiten im Steuer- und Sozialversicherungsrecht
I. Steuerrecht
1. Einkommensteuer
2. Umsatzsteuer
3. Gewerbesteuer
II. Künstlersozialversicherungsrecht
1. Allgemeines
2. Fotografen in der Künstlersozialversicherung
a) Künstler und Publizist gemäß § 2 KSVG
b) Selbstständige Erwerbstätigkeit
c) Mindest- und Höchstgrenze des Arbeitseinkommens
d) Befreiung von der Versicherungspflicht
e) Vorgezogenes Krankengeld
3. Die Künstlersozialabgabe für Unternehmen und Verwerter
a) Abgabepflicht gemäß § 24 KSVG
b) Wie hoch ist die Künstlersozialabgabe und worauf ist sie zu zahlen?
c) Pflichten der Unternehmen
Literaturverzeichnis
Rechtsprechungsübersicht
Stichwortverzeichnis
Zur Homepage von
JournalistenBlattWir möchten Ihnen den Zugang zu der gesamten hier präsentierten Fachliteratur ermöglichen. Zahlreiche Bücher sind bei Amazon und einige wenige Bücher nur direkt über den Anbieter erhältlich. Deswegen bitten wir um Ihr Verständnis, wenn nicht alle Bücher einheitlich über einen Warenkorb bestellt werden können.
Bei Versand über Amazon bzw. bei Direktbestellung:
Bitte die dortigen Konditionen beachten.
Bei Versand über Amazon bzw. bei Direktbestellung:
Bitte die dortigen Konditionen beachten.
Allgemeine Geschäftsbedingungen